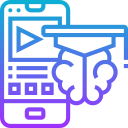Klassenmanagement in virtuellen Räumen
Vor Start: Sicherheitszone markieren, Stoppsignal vereinbaren, Headset-Regel erklären. Währenddessen: kurze Check-ins, Handzeichen für Hilfe. Nachher: geordnetes Ablegen, Desinfektion, Debrief. Diese Struktur mindert Chaos und stärkt Konzentration, besonders bei ersten Erfahrungen oder gemischten Lerngruppen.
Klassenmanagement in virtuellen Räumen
Planen Sie knappe Sessions in Blöcken von zehn bis fünfzehn Minuten, mit frischer Luft, Wasser und Blickwechsel. Pausen sind Lernzeit: kurze Notiz, Mini-Diskussion, Ziel justieren. So bleiben Aufmerksamkeit, Motivation und Komfort stabil, ohne den roten Faden zu verlieren.